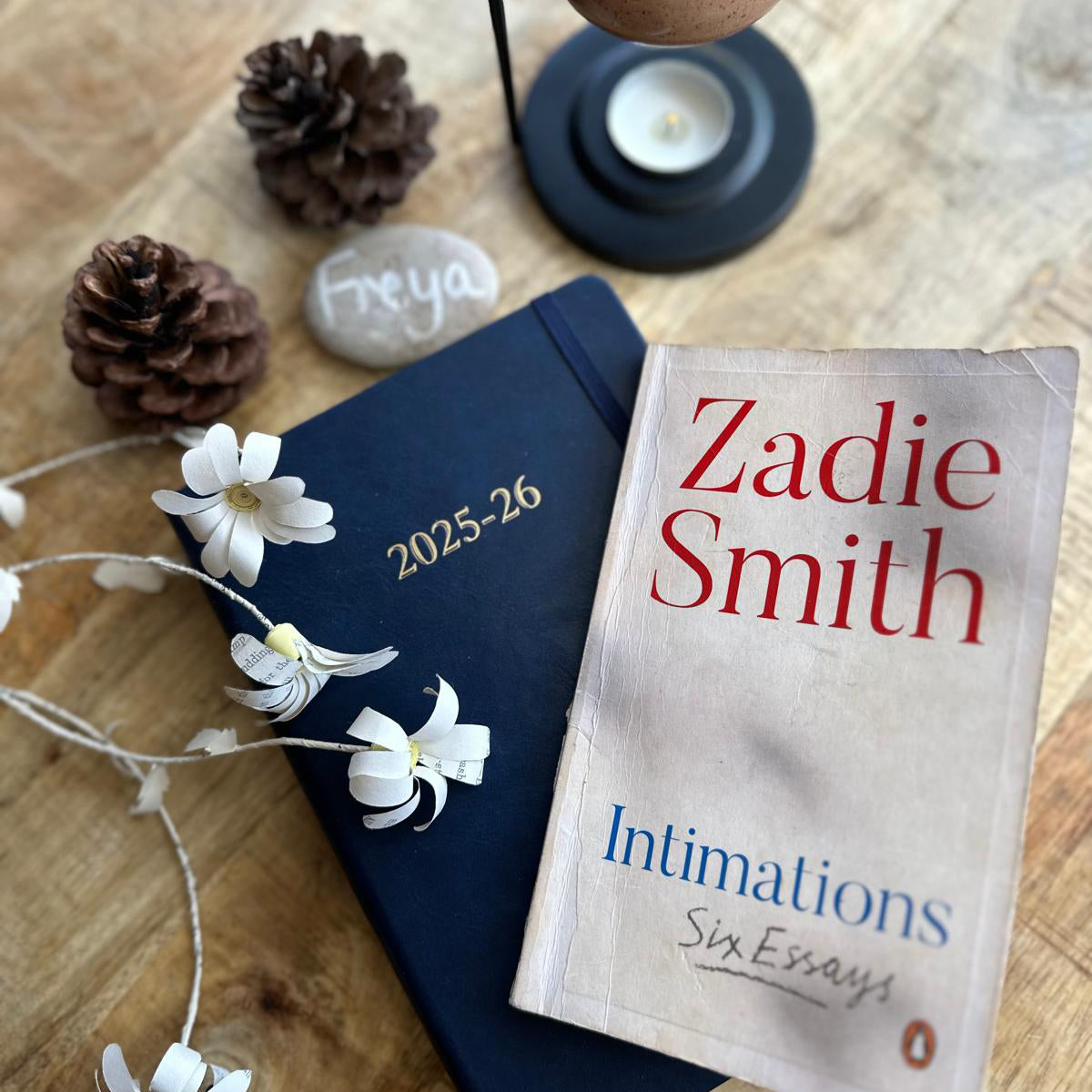Artikel: Wykehams Buchclub – Mihail Sebastian, Frauen (1933)
Wykehams Buchclub – Mihail Sebastian, Frauen (1933)

Diese Woche besprechen wir „Frauen“ von Mihail Sebastian.
Diese erstmals 1933 erschienene Novelle ist eine verführerische, berauschende und bisweilen beunruhigende Erzählung. Sie erkundet die Beziehungen, die der Protagonist Stefan zu den Frauen eingeht, denen er im Laufe seines Lebens begegnet.
Stefan beginnt die Novelle als junger Medizinstudent, von einer weiblichen Figur sehnsüchtig als „un noveau jeune homme“ (ein neuer junger Mann) gepriesen. Diese vier Worte fassen treffend all jene Eigenschaften zusammen, die ihn so anziehend machen. Seine Jugend verrät Unschuld und verbirgt zugleich eine ihm innewohnende Sexualität; er könnte einfach nur ein junger Mann sein oder das Objekt ungezügelter Begierde. Er ist etwas, das es zu entdecken, zu ergründen und zu erforschen gilt.
Stefans Sichtweise wirkt mal jungenhaft und neugierig, mal räuberisch und kontrollierend. Sein scheinbares Selbstvertrauen kann verwirrend sein; ich fragte mich, ob es ein Zeichen von Erfahrung – seiner Frühreife – oder eben deren Fehlen war.
Sebastian kultiviert ein flexibles Erzählsystem, in dem er gekonnt zwischen Stefans Perspektive und einer distanzierten, allwissenden Erzählweise wechselt: „Stefan hat Erfahrung mit der Wirkung solcher höflicher Zurückweisungen. Er redet sich ein, dass Madame Bonneaus selbstsichere Fassade ihnen gegenüber schließlich zusammenbrechen wird.“ Die Erzählung besitzt eine hypnotische Nähe und Unmittelbarkeit. Wie John Banville bemerkt, hat sie „einen Hauch von Autobiografischem“. Tatsächlich lassen sich Parallelen zwischen Sebastians posthum veröffentlichten Tagebüchern (1996), die seine Liebesaffären und Beziehungen dokumentieren, und „ Frauen“ ziehen, wenn man möchte.
Kurze Einblicke in die Gedankenwelt der Frauen, die Stefan umwirbt („Madame Bonneau beobachtete ihn aufgeregt, da sie wegen Madame Rey nicht wusste, wie sie ihre Bitte konkret formulieren sollte“), sind willkommen, denn weder Stefan noch der Erzähler sind für Empathie bekannt; es ist mitunter schwer zu unterscheiden, wer wer ist. Nachdem Renée sich entkleidet hat, erfahren wir, dass sie „einen hässlichen Körper“ hat. Ob dieser Gedanke von Stefan stammt, bleibt zunächst unklar.
Die Passage fährt fort: „Erst in der Kühle des Abends, wenn sie ihren bestickten Seidenschal über die Schultern wirft und ihren Körper darin einhüllt, gewinnt sie ihre natürliche Anmut zurück. Jene Anmut, die Stefan bei ihrer ersten Begegnung distanziert wahrgenommen hatte.“ Stefan hat also ihre Anmut bemerkt (wenn auch distanziert), aber bemerkte er auch die Hässlichkeit ihres Körpers? Uns bleibt der Eindruck einer jungen Frau, nackt und dem urteilenden, aber nicht zuzuordnenden männlichen Blick ausgeliefert.
Es ist in der Tat interessant, dass der Schal, den Renée um ihren Körper legt, an die Sonne erinnert, „warm wie ein Schal“, die Stefan im ersten Absatz beschreibt. Beschränkt sich Stefans Beziehung zu diesen Frauen etwa nur auf körperliche Empfindungen? Er scheint sich jedenfalls vor jeder tiefergehenden emotionalen Identifikation zu schützen und bevorzugt Körper, die ihm Lust und Grenzen zum Ausloten versprechen, gegenüber den Seelen, die in ihnen wohnen und ihrerseits die von ihm so entschieden verteidigten Barrieren bedrohen könnten.
Die aus dem Rumänischen übersetzte Sprache ist fließend und enthält Momente von wahrhaft musikalischer Komposition: „Es ist noch nicht acht Uhr. Stefan Valeriu erkennt es am Sonnenlicht, das sich nur bis zum Rand seiner Chaiselongue vorgearbeitet hat. Er spürt, wie es an den Holzbeinen emporsteigt, seine Finger, seine Hände, seinen nackten Arm streichelt.“ Als Leser kann man Stefans Sichtweise leicht nachvollziehen. Tatsächlich empfand ich es als eine gewisse Selbstbeherrschung, mich gegen seinen lässig-entwaffnenden Charme und seine gelegentliche, selbstherrliche Überlegenheit zu wehren: „Renée brach in Tränen aus. Gute, herzliche Tränen, die Stefan ihr schenkte, indem er ihre Hände streichelte und das Weinen mit Gleichmut aufnahm, wie den Regen.“
Stefan ist eine vielschichtige Persönlichkeit. Seine Gedanken über Frauen schwanken zwischen Bewunderung, Neugier und mitunter ätzender Verurteilung. Er ist gleichermaßen begehrend wie kritisch gegenüber dem weiblichen Körper. Und die Beziehungen sind bewegend, weil sie Fragen nach Kontrolle, Bedürfnis und der Bequemlichkeit aufwerfen, die Beziehungen im Gewand der Liebe bieten können.
Ein Abschnitt des Buches ist Marias Perspektive gewidmet. Offenbar standen sie und Stefan einst kurz vor einer Romanze. Anfangs erscheint sie als wissende Fatalistin, die in einer unerfüllten Beziehung mit einem Mann namens Andrei verharrt. Er ist abweisend und schätzt nur die Stabilität und den stoischen Pragmatismus, die sie bietet. Für Stefan ist sie interessant, weil sie ihn daran erinnert, was hätte sein können. Ihr scheinbar entschlossener Realismus wird in einer Form ausgedrückt, die Briefform sein könnte; es könnten aber auch ihre privaten Gedanken sein. Ob Stefan sie hört, bleibt unklar. Die Unbestimmtheit der Form, in der sie sich ausdrückt (ist es ein Brief? Ein innerer Monolog?), ihre fragwürdige Beziehung zu Stefan und die Gründe, warum sie an einem Mann festhält, der ihr keine Verbindlichkeit entgegenbringt, führen zu Verwirrung in unserer Wahrnehmung als Leser. Gerade die Fragen, die sie aufwirft, machen sie so interessant.
Es ist jedoch schwer zu sagen, ob Stefan eine dieser Frauen wirklich liebt. Unser eigenes Verständnis von Liebe scheint durch das unruhige Zusammenspiel von Erotik, Lust, Ungezwungenheit und Vertrautheit verkompliziert zu werden. Tatsächlich ist es die chemische Mischung dieser körperlichen und sinnlichen Erfahrungen, die Stefan auf einer tiefen, instinktiven wie intellektuellen Ebene zu fesseln scheint. Dies lässt uns fragen, ob Stefan jemals jemanden so sehr lieben kann wie sich selbst und ob Liebe jemals wirklich frei von Eigeninteresse sein kann.
Stefan bleibt am Ende des Romans allein zurück, nachdem seine letzte Liebe, Arabela, gegangen ist (sie, die nie viel Wert auf Konventionen legte, kündigt ihren Abschied mit den Worten an: „Was würdest du sagen, Stefan, wenn ich mit Beb durchbrennen würde?“). Der letzte Satz klingt wie ein Vorbote des bevorstehenden Zweiten Weltkriegs: „Ich ging in die Stadt und kaufte mir auf dem Weg die Zeitungen, um zu sehen, was an diesem Morgen beim Völkerbund geschehen war. Es hatte hitzige Debatten gegeben.“ Als rumänischer Jude spüren wir in dieser letzten Zeile die Schwere von Sebastians persönlicher und nationaler Auseinandersetzung. Dies könnte von manchen als weiterer Grund gewertet werden, Autor und Erzähler zu verschmelzen.
Doch welche Schlüsse man auch ziehen mag, wir bleiben fest von Stefans unergründlichem Wesen überzeugt. Es ist diese Einfachheit – diese unvergleichlich lebendige Darstellung –, die Stefan und seinen Erzähler so zeitlos macht. In ihrem Widerstand gegen das Begreifen steckt etwas von uns allen.
Freya Morris, Wykeham's